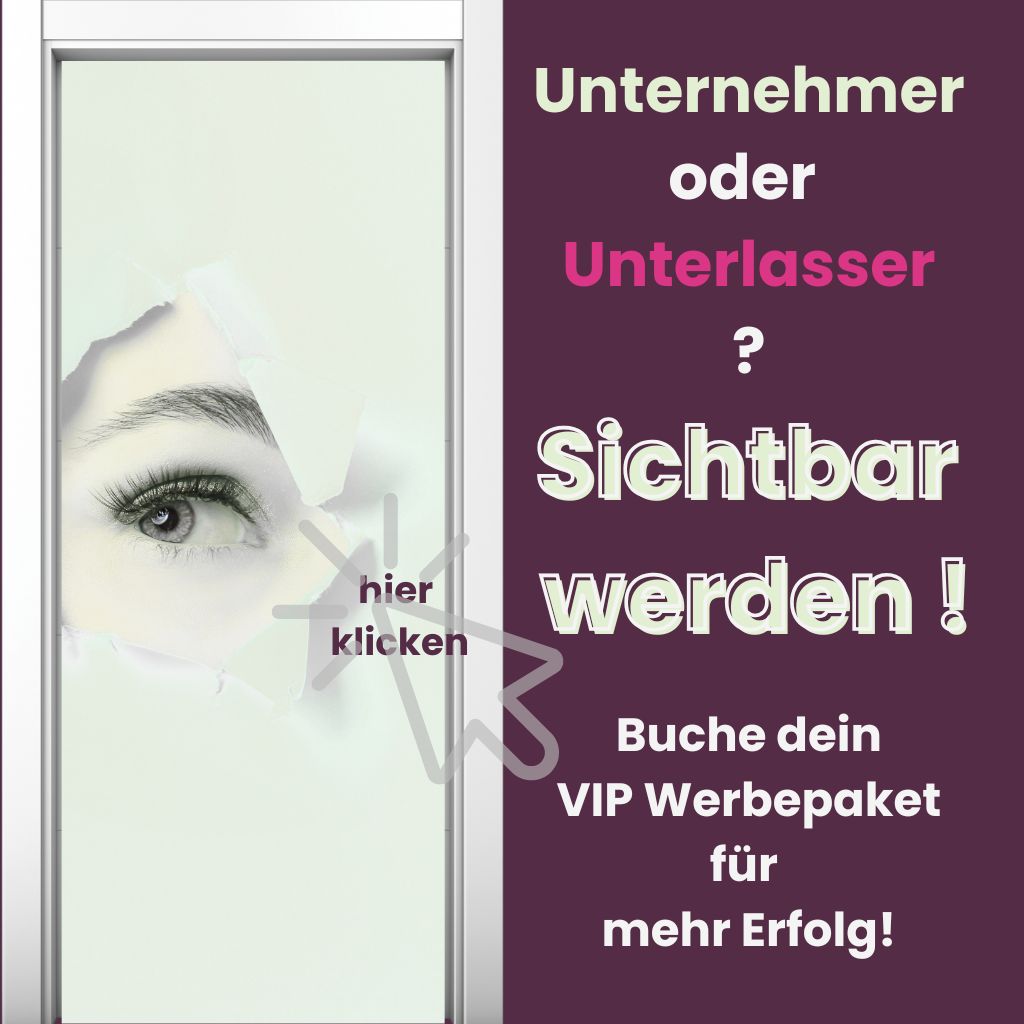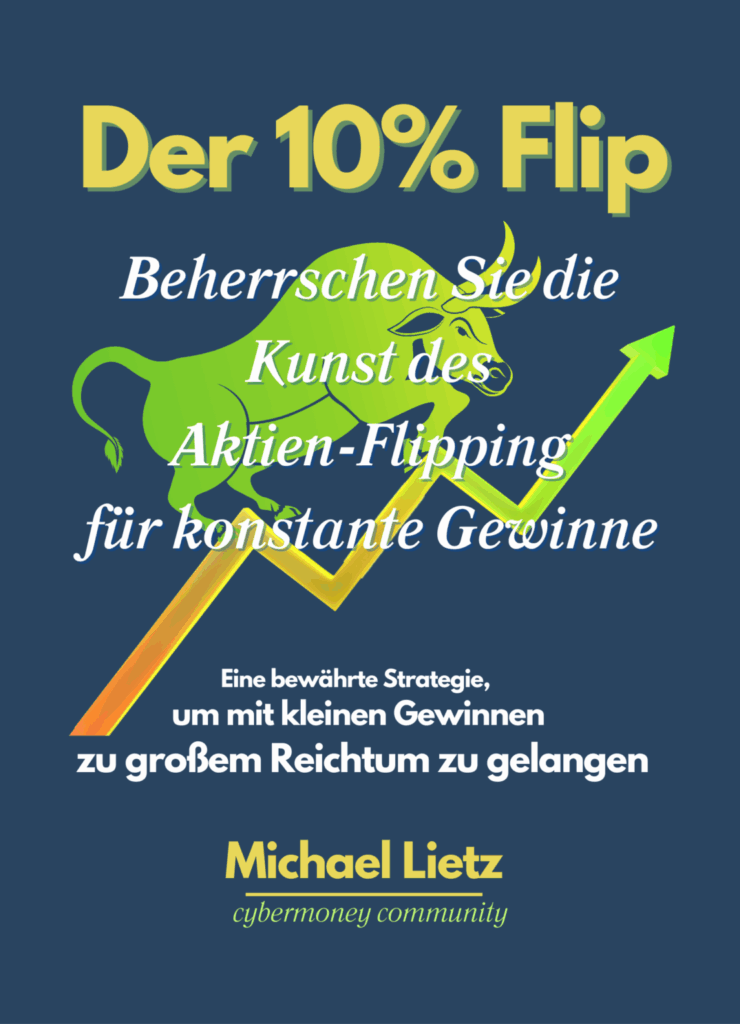Als der Krieg noch in der Ferne tobte und die Welt ahnungslos auf den Abgrund zusteuerte, trug ein Mann in seiner Vorstellung bereits die Zukunft einer ganzen Stadt in der Tasche. Adolf Hitler, der in seiner Jugend in Linz aufgewachsen war, hielt an einer Vision fest, die weit über persönliche Nostalgie hinausging. Er wollte aus Linz eine monumentale „Führerstadt“ formen, ein Machtzentrum, das nicht nur Wien überstrahlen, sondern Paris und Rom in den Schatten stellen sollte. Die Pläne waren kühn, gigantisch – und zutiefst zerstörerisch.
In Hitlers Entwürfen verschwand das gewachsene Gesicht der Stadt. Der barocke Hauptplatz, über Jahrhunderte Herz und Bühne des bürgerlichen Lebens, sollte dem Erdboden gleichgemacht werden. An seine Stelle wären strenge Achsen aus Stein getreten, breite Prachtstraßen, die in ihrer Kälte und Symmetrie das nationalsozialistische Ideal von Macht und Ordnung in Architektur übersetzt hätten. Ein neues Kulturzentrum, so groß wie ein Stadtviertel, sollte entstehen – nicht um die Vielfalt der Kunst zu feiern, sondern um sie auf eine ideologisch gereinigte Form zu reduzieren.
In diesen Planungen, die unter dem Namen „Führerstadt Linz“ Gestalt annahmen, verbargen sich mehr als nur städtebauliche Überlegungen. Sie waren Ausdruck eines gigantomanischen Weltbildes, in dem Geschichte und Gegenwart Platz machen mussten für den steinernen Traum eines einzigen Mannes. An der Donau sollte ein Museumskomplex von nie gekanntem Ausmaß entstehen, ausgestattet mit Kunstwerken aus halb Europa – viele davon geplündert. Linz sollte so zu einem „Mekka der Kultur“ im Sinne des Regimes werden, ein Ort, an dem sich Macht und Ästhetik vereinten, um die Ideologie der Nationalsozialisten auf subtile wie brutale Weise zu verankern.
Doch die Architektur, die Hitler vorschwebte, war nicht nur groß, sie war erdrückend. Monumentale Bauwerke, in denen der Mensch klein und unbedeutend erschien, sollten die Oberhand gewinnen. Wo heute Menschen über Kopfsteinpflaster schlendern, wären steinerne Kolosse aufgestiegen, deren gewaltige Fassaden kein Lichtspiel, keinen Schatten aus dem Zufall zugelassen hätten. Jeder Blick wäre gelenkt, jede Bewegung eingehegt gewesen von der strengen Choreografie einer Stadt, die nicht für das Leben, sondern für die Macht gebaut worden wäre.
Die Kriegsjahre verhinderten, dass diese Vision jemals umgesetzt wurde. Die Entwürfe verschwanden in den Schubladen, die Modelle verstaubten, und das historische Linz blieb – wenn auch gezeichnet von der Zeit – bestehen. So entging der Hauptplatz seiner geplanten Auslöschung. Das Pflaster, das schon Märkte, Feste und Demonstrationen gesehen hatte, blieb der Stadt erhalten, wie auch die Fassaden, die Generationen vor Hitler geprägt hatten.
Heute wirkt dieser Plan wie ein dunkler Schatten, der sich kurz über die Stadt legte, ohne sie zu verschlingen. Doch das Wissen um diese beinahe eingetretene Zerstörung schärft den Blick für den Wert historischer Substanz. Man kann über den Hauptplatz gehen, die Säulen, Giebel und Fenster betrachten und dabei spüren, wie knapp Linz einem Verlust entgangen ist, der nicht nur ein architektonischer, sondern ein tiefer Bruch in seiner Seele gewesen wäre. Die Geschichte der „Führerstadt“ ist eine Erinnerung daran, dass Machtträume aus Stein oft nur Masken sind – und dass das wahre Herz einer Stadt nicht aus Monumenten besteht, sondern aus den Stimmen und Schritten der Menschen, die sie bewohnen.